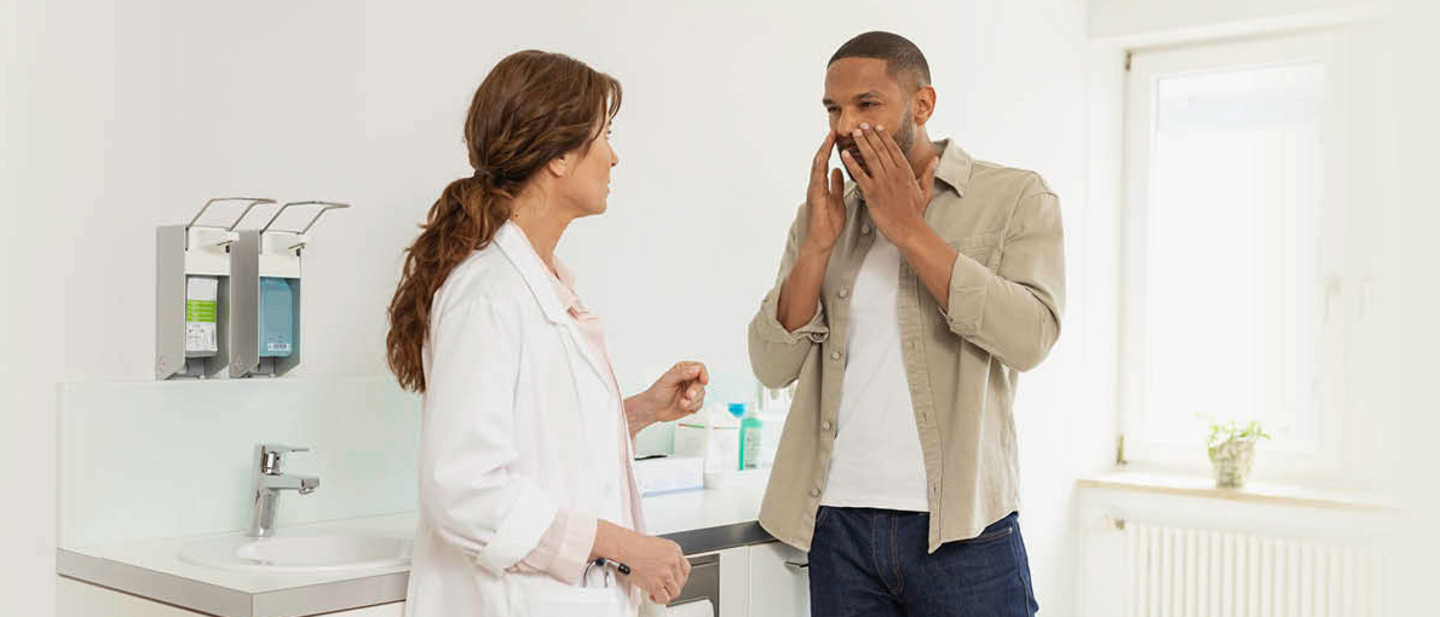
Erst eine verstopfte Nase, dann das Gefühl von Schleim, der den Hals hinunterläuft – und schließlich eine Bronchitis. Was wie eine Abfolge unangenehmer Beschwerden wirkt, ist häufig eine sogenannte Sinubronchitis (auch sinubronchiales Syndrom genannt). Dabei tritt nach dem Start einer Nasennebenhöhlenentzündung zusätzlich auch eine Bronchitis auf – meist durch den sogenannten Etagenwechsel; dieser bezeichnet das „Hinabsteigen“ einer Entzündung der oberen Atemwege in die unteren Atemwege. Für Betroffene ist das nicht nur sehr unangenehm, sondern es kann den Alltag deutlich negativ beeinträchtigen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Ursachen dahinterstecken, wie sich eine Sinubronchitis äußert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wann ärztliche Hilfe wichtig ist.
Eine Sinubronchitis (auch sinubronchiales Syndrom oder Sinus-Bronchitis genannt) beschreibt das gleichzeitige Auftreten einer Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) und einer Bronchitis. Auslöser ist häufig ein sogenannter Etagenwechsel: Entzündungen oder Infekte beginnen in den oberen Atemwegen – etwa in Nase oder Nasennebenhöhlen – und breiten sich anschließend auf die unteren Atemwege aus. Zunächst stehen Symptome wie verstopfte Nase, Druckgefühl im Gesicht oder Sekretfluss in den Rachen im Vordergrund, gefolgt von Husten, verschleimten Bronchien und Brustschmerzen.
Medizinisch wird die Sinubronchitis dem Konzept der „United Airways“ zugeordnet, das die Atemwege als funktionale Einheit sieht: Entzündliche Prozesse in den oberen Schleimhäuten können demnach direkt die unteren Atemwege beeinflussen und eine Verbindung z. B. zwischen Sinusitis und Bronchitis herstellen [1].
Für Betroffene bedeutet das: Ein scheinbar harmloser Schnupfen kann in eine komplexere Atemwegserkrankung übergehen. Unterstützend können Nasenspülungen oder Inhalationen mit Kochsalzlösungen die natürliche Selbstreinigung der Atemwege fördern und so helfen, eine Ausbreitung in die Bronchien zu vermeiden.
Eine Sinubronchitis wird meist durch einen akuten Atemwegsinfekt – oft eine gewöhnliche Erkältung – ausgelöst. Die meisten Infekte sind viral bedingt. Warum sich bei manchen Betroffenen aus einer zunächst harmlosen Infektion eine Kombination aus Sinusitis und Bronchitis entwickelt, ist nicht abschließend geklärt. Fachlich geht man von multifaktoriellen Ursachen aus, bei denen sowohl individuelle Veranlagung als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen können.
Die wichtigsten Risikofaktoren lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
Ein gemeinsamer Schlüsselmechanismus ist die gestörte mukoziliäre Clearance: Wenn Schleim nicht mehr effektiv abtransportiert wird, können Krankheitserreger leichter aus den oberen Atemwegen in die Bronchien gelangen und eine Bronchitis hervorrufen – der sogenannte Etagenwechsel.
Eine Sinubronchitis zeigt sich durch eine Kombination aus Beschwerden der oberen und unteren Atemwege. Typisch ist, dass zunächst die Symptome einer Sinusitis im Vordergrund stehen und sich im Verlauf Anzeichen einer Bronchitis hinzugesellen. Die wichtigsten Symptome lassen sich daher in zwei Gruppen einteilen:
Viele Betroffene empfinden diese Kombination als besonders belastend: Während die verstopfte Nase das Atmen erschwert und Mundatmung den Hustenreiz zusätzlich fördert, raubt der nächtliche Husten den Schlaf – mit Folgen wie Tagesmüdigkeit und eingeschränkter Leistungsfähigkeit.

Die Diagnose einer Sinubronchitis wird immer von einer Ärztin oder einem Arzt gestellt. In den meisten Fällen reicht eine klinische Untersuchung aus – damit ist die Kombination aus Gespräch über die Beschwerden (Anamnese) und einer einfachen körperlichen Untersuchung gemeint. Die Ärztin oder der Arzt fragt nach Symptomen wie verstopfter Nase, Schleimfluss in den Rachen und anhaltendem Husten. Anschließend werden Nase, Rachen und Bronchien untersucht: Häufig schaut die Ärztin oder der Arzt mit einem kleinen Licht in die Nase, tastet den Kopfbereich ab und hört die Lunge mit dem Stethoskop ab (Auskultation).
Zusätzlich können folgende Untersuchungen sinnvoll sein:
Für die meisten Betroffenen ist wichtig zu wissen: Oft reicht schon die Anamnese und körperliche Untersuchung aus, um eine Sinubronchitis zu diagnostizieren. Aufwändigere Verfahren kommen nur in besonderen Fällen zum Einsatz.
Die Therapie einer Sinubronchitis hängt davon ab, wie stark die Beschwerden ausgeprägt sind und ob es sich um eine akute oder wiederkehrende Form handelt. Ziel ist es, die Entzündung zu lindern, Schleim zu lösen und Komplikationen zu vermeiden.
Da bei einer Sinubronchitis die Bronchien beteiligt sind, stehen Maßnahmen im Vordergrund, die die Schleimlösung fördern und das Abhusten erleichtern:
Tipps wie ausreichend viel zu trinken und das Immunsystem zu stärken sind zwar nie schlecht, helfen aber nicht gezielt, wenn die Bronchien und Nasennebenhöhlen bereits betroffen sind.
Wenn die Beschwerden stark sind oder länger als zwei bis drei Wochen bestehen, können Medikamente notwendig sein. Typischerweise kommen zum Einsatz:
In seltenen Fällen, etwa bei chronischen oder therapieresistenten Verläufen, kann die Ärztin oder der Arzt auch operative Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Belüftung der Nasennebenhöhlen zu verbessern.
Die Sinubronchitis selbst ist nicht direkt ansteckend. Sie entsteht meist als Folge einer Erkältung oder eines Atemwegsinfekts, der durch Viren ausgelöst wird. Diese Viren können in der akuten Phase sehr wohl ansteckend sein – ähnlich wie bei einer normalen Erkältung. Bei Infizierten können diese aber auch einfach einen akuten Atemwegsinfekt auslösen.
Welche Medikamente eingesetzt werden, hängt von der Ursache der Erkrankung ab. Häufig verordnen Ärztinnen und Ärzte Kortison-Nasensprays gegen die Entzündung der Nasennebenhöhlen und Schleimlöser für die Bronchien. Antibiotika sind nur nötig, wenn eine bakterielle Infektion nachgewiesen ist. In den meisten Fällen ist der Auslöser jedoch viral bedingt. Bei Allergien können auch Antihistaminika sinnvoll sein.
Eine akute Sinubronchitis heilt in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen aus. Dauern die Beschwerden länger an oder treten sie immer wieder auf, sollte eine chronische Ursache – etwa eine chronische Sinusitis oder Bronchitis – ärztlich abgeklärt werden.
Hilfreich sind vor allem Inhalationen mit Kochsalzlösung, da sie die Schleimhaut abschwellen und den Schleim lösen und so die Atemwege befreien können. Auch Nasenspülungen können unterstützen. Wenn die Beschwerden stärker ausgeprägt sind, sollte die Therapie ärztlich begleitet und mit Medikamenten ergänzt werden.
In den meisten Fällen heilt eine Sinubronchitis folgenlos ab. Bleiben die Beschwerden jedoch länger bestehen oder verschlimmern sie sich, können Folgeerkrankungen wie eine chronische Sinusitis oder Bronchitis entstehen. Spätestens dann ist ärztliche Hilfe erforderlich.
[1] Klain A, et al. United airway disease. Acta Biomed. 2021 Nov 29;92(S7):e2021526. doi: DOI: 10.23750/abm.v92iS7.12399
Hinweis: Der Inhalt des Beitrags stellt keine Therapieempfehlung dar. Die Bedürfnisse von Patienten sind individuell sehr verschieden. Vorgestellte Therapieansätze sollen nur als Beispiele dienen. PARI empfiehlt Patienten, sich stets mit ihrem behandelnden Hausarzt oder Facharzt abzusprechen.
Wie hilfreich sind diese Informationen für Sie?